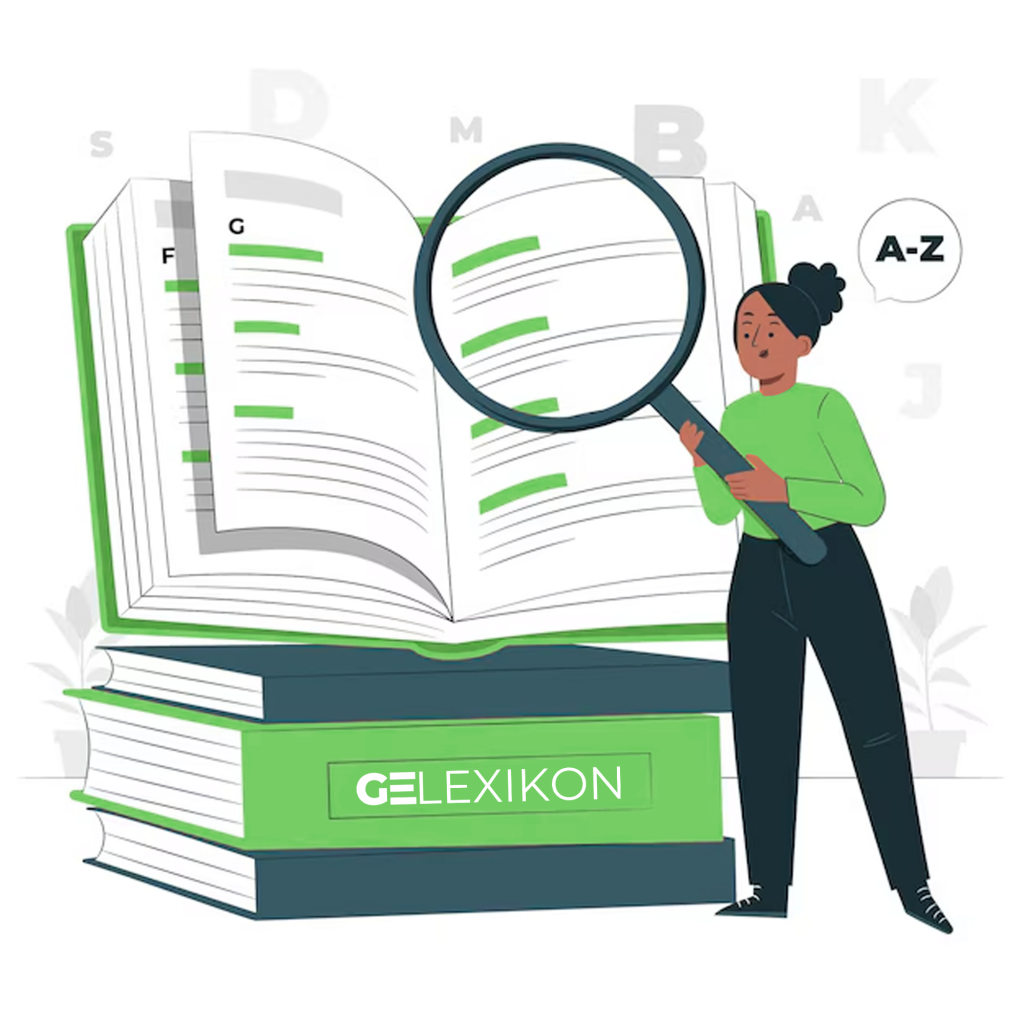
Das große Energielexikon
Wissen, das bewegt.
Im GE LEXIKON finden Sie die wichtigsten Begriffe, Wörter und Zusammenhänge aus der Welt der erneuerbaren Energien – einfach erklärt, fundiert recherchiert und ständig erweitert.
Von A wie Autarkie bis Z wie Zählerfernauslesung – unser Lexikon bietet Ihnen einen schnellen Überblick über alle relevanten Themen im Energiemarkt.
Ob als Immobilienbesitzer, Investor, Vertriebspartner oder Technik-Profi: Hier finden Sie das Wissen, das Sie brauchen, um im Energiemarkt mitzureden – und mitzugestalten.
Autarkie
Die Fähigkeit eines Haushalts oder Unternehmens, sich unabhängig vom öffentlichen Stromnetz mit Energie zu versorgen – meist durch eigene Photovoltaikanlagen und Speicherlösungen.
Aufdachanlage
Eine Photovoltaikanlage, die auf das bestehende Dach eines Gebäudes montiert wird. Sie ist einfacher zu installieren als Indachlösungen und besonders weit verbreitet.
Anlagenüberwachung
Systeme und Softwarelösungen zur Echtzeitüberwachung von PV-Anlagen, um Leistung, Ertrag und Fehler frühzeitig zu erkennen und zu optimieren.
Amortisationszeit
Die Zeitspanne, nach der sich die Investition in eine Photovoltaikanlage durch Einsparungen oder Einnahmen refinanziert hat.
Anlagenzertifikat
Ein technisches Dokument, das bestätigt, dass eine PV-Anlage den geltenden Normen und Netzanschlussbedingungen entspricht – oft notwendig bei größeren Anlagen.
AC-Seite
Der Wechselstrom-Bereich einer PV-Anlage – also der Teil nach dem Wechselrichter, der Strom ins Hausnetz oder öffentliche Netz einspeist.
Arbeitspreis
Der Preis, den Energieversorger pro verbrauchter Kilowattstunde Strom berechnen – neben dem Grundpreis ein wichtiger Bestandteil deiner Stromrechnung.
Anlageneffizienz
Kennzahl für die Leistungsfähigkeit einer PV-Anlage, gemessen an der Menge Strom, die im Verhältnis zur installierten Kapazität tatsächlich erzeugt wird.
Ausrichtung
Bezieht sich auf die Himmelsrichtung, in die eine PV-Anlage zeigt – idealerweise Süden, um maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen.
Anschlussleistung
Die maximale elektrische Leistung, die eine PV-Anlage einspeisen oder ein Gebäude aus dem Netz beziehen kann. Wichtig für Vertrags- und Netzanschlussfragen.
Ausschreibung
Ein staatliches Verfahren, bei dem Projektentwickler für große PV-Anlagen um die Förderhöhe bieten – der Zuschlag geht an das günstigste Gebot.
Anlagenerweiterung
Die nachträgliche Vergrößerung einer bestehenden PV-Anlage, etwa durch zusätzliche Module oder Speichereinheiten, um den Eigenverbrauch zu steigern.
Anlagenbetreiber
Die Person oder Organisation, die eine PV-Anlage betreibt und für Wartung, Abrechnung und Netzanmeldung verantwortlich ist.
Abregelung
Die gezielte Reduzierung der Einspeiseleistung einer PV-Anlage, z. B. bei Netzüberlastung – vorgeschrieben durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
Anlagensimulation
Softwaregestützte Ermittlung des zu erwartenden Energieertrags einer PV-Anlage, basierend auf Standort, Ausrichtung und Modultypen.
Ausschaltzeit
Die Zeit, die ein Wechselrichter oder ein anderes System benötigt, um sich bei Netztrennung automatisch vom Stromnetz zu trennen – wichtig für Sicherheit.
Akkumulator
Ein technischer Begriff für einen wiederaufladbaren Energiespeicher – im PV-Bereich meist ein Lithium-Ionen- oder Bleiakku.
Anlagenertrag
Die tatsächlich erzeugte Energiemenge einer PV-Anlage in einem bestimmten Zeitraum – entscheidend für Wirtschaftlichkeitsberechnungen.
Abnahmevertrag
Vertragliche Vereinbarung zwischen Anlagenbetreiber und Energieversorger, in dem geregelt ist, zu welchen Bedingungen der Strom eingespeist wird.
Anlagenmonitoring
Fortlaufende Überwachung der Anlagenleistung zur schnellen Erkennung von Störungen, Ausfällen oder Minderleistung – oft per App oder Webportal.
Balkonkraftwerk
Ein kleines Photovoltaiksystem für Balkon, Terrasse oder Garten, das direkt Strom ins Haushaltsnetz einspeist – ideal für Mieter oder Eigentümer mit wenig Platz.
Betreiberpflichten
Gesetzliche und technische Vorgaben, die Betreiber von PV-Anlagen erfüllen müssen – z. B. Anmeldung beim Netzbetreiber oder Einhaltung technischer Standards.
Bezugspreis
Der Preis, den ein Haushalt pro Kilowattstunde vom Energieversorger bezahlt – wichtig für die Wirtschaftlichkeit von Eigenverbrauch.
Batteriespeicher
Eine Einheit, die überschüssigen Solarstrom speichert und bei Bedarf wieder ins Hausnetz abgibt – erhöht die Autarkie deutlich.
Blindleistung
Elektrische Leistung, die für den Energiefluss notwendig ist, aber nicht in nutzbare Energie umgewandelt wird – spielt bei Netzstabilität eine Rolle.
Baulast
Eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, die bei der Planung von PV-Projekten rechtlich beachtet werden muss.
Betreiberwechsel
Wenn eine PV-Anlage an einen neuen Eigentümer übergeht – oft bei Immobilienverkauf. Erfordert eine Ummeldung beim Netzbetreiber.
Bewirtschaftungskosten
Laufende Kosten für Wartung, Versicherung und Betrieb einer PV-Anlage – wichtig für die Berechnung der Rendite.
Baurecht
Regelt, ob und wie eine PV-Anlage auf einem Grundstück errichtet werden darf – besonders relevant bei Freiflächenanlagen.
Brandschutz
Sicherheitsvorkehrungen, die bei Planung und Betrieb einer PV-Anlage beachtet werden müssen – etwa Brandschutzabstände oder Materialvorgaben.
Bauleitung
Verantwortliche Überwachung und Koordination der Bauphase einer PV-Anlage – sorgt dafür, dass alles fachgerecht umgesetzt wird.
Betonfertigteilfundament
Vorgefertigtes Fundament aus Beton, das bei Freiflächenanlagen verwendet wird, um Module stabil und schnell montieren zu können.
Betreiberkonzept
Detaillierter Plan zur Realisierung, Finanzierung, Nutzung und Abrechnung einer PV-Anlage – vor allem bei Mieterstrom und größeren Anlagen wichtig.
Bilanzkreis
Ein virtueller Energieraum, in dem Stromerzeugung und -verbrauch bilanziert werden – wichtig für die Stromvermarktung am Energiemarkt.
Belegungsplan
Technische Zeichnung oder Plan, der zeigt, wie viele PV-Module auf einer Dach- oder Freifläche installiert werden können.
Betreibergesellschaft
Eine Gesellschaft (z. B. GmbH oder GbR), die für Bau, Betrieb und Vermarktung einer oder mehrerer PV-Anlagen verantwortlich ist.
Bezugspunktmessung
Messkonzept, bei dem der gesamte Stromverbrauch und -bezug an einem Punkt im Gebäude erfasst wird – Voraussetzung für bestimmte Abrechnungsmodelle.
Bündelung
Zusammenfassung mehrerer PV-Anlagen zu einer Einheit – z.B. für die gemeinsame Direktvermarktung oder Anlagenüberwachung.
Bafa-Förderung
Finanzielle Unterstützung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle – z.B. für Stromspeicher oder effiziente Heizsysteme.
Bezugssperre
Technische Möglichkeit, bei Stromausfällen oder bestimmten Betriebszuständen den Strombezug vom Netz vollständig zu unterbrechen – z.B. bei Notstromsystemen.
CO₂-Bilanz
Eine Kennzahl, die angibt, wie viel Kohlendioxid durch eine bestimmte Aktivität, ein Produkt oder ein System ausgestoßen wird – wichtig zur Bewertung der Umweltwirkung.
CEE-Steckdose
Eine industrielle Steckverbindung mit hoher Strombelastbarkeit – wird oft für die Einspeisung größerer PV-Anlagen oder Batteriespeicher verwendet.
Contracting
Ein Geschäftsmodell, bei dem ein Dienstleister (Contractor) die Investition, Installation und Wartung einer PV-Anlage übernimmt – oft mit langfristigem Energieverkauf.
CIGS-Modul
Dünnschichtmodul auf Basis von Kupfer, Indium, Gallium und Selen – besonders leicht, flexibel und optisch ansprechend, aber teurer in der Herstellung.
CO₂-Zertifikat
Ein handelbares Recht zur Emission einer bestimmten Menge CO₂ – relevant im Kontext von Klimapolitik und nachhaltigem Wirtschaften.
Cycling (Batterie)
Gibt an, wie oft ein Batteriespeicher vollständig ent- und wieder aufgeladen werden kann – wichtig für die Lebensdauer.
Curtailment
Das gezielte Abregeln von PV-Anlagen bei Netzüberlastung – entweder lokal durch den Netzbetreiber oder automatisiert per Technik.
C-Rate
Maß für die Lade- oder Entladerate einer Batterie – je höher, desto schneller kann Energie ein- oder ausgespeist werden.
Cluster
Eine Gruppe von mehreren PV-Anlagen oder Komponenten, die gemeinsam überwacht oder gesteuert werden – wichtig für Monitoring oder Großprojekte.
Carbon Footprint
Der ökologische Fußabdruck einer Person, eines Unternehmens oder Produkts in Form von CO₂-Emissionen.
CEE-Verbindung
Industriestandard für Steckverbindungen bei höheren Stromstärken – oft notwendig bei größeren Energieanlagen.
COP-Wert
"Coefficient of Performance" – Kennzahl für die Effizienz z.B. von Wärmepumpen. Ein COP von 4 heißt: Aus 1 kWh Strom werden 4 kWh Wärme.
Cycle Stability
Gibt an, wie gut ein Energiespeicher über viele Ladezyklen hinweg seine Kapazität hält – beeinflusst Wartungsintervalle und Wirtschaftlichkeit.
Curtailment Management
Strategien und Systeme, um Erzeugungsspitzen zu kontrollieren, z.B. durch Zwischenspeicherung oder gesteuertes Abregeln.
Cloud Speicher
Virtuelles Stromkonto beim Energieversorger: Überschüssiger Solarstrom wird „gespeichert“ und kann später wieder abgerufen werden.
Carbon Pricing
Bepreisung von CO₂-Emissionen zur Lenkung von Investitionen in nachhaltige Technologien – Grundlage vieler Förderprogramme.
Cell Efficiency
Gibt an, wie effizient eine Solarzelle das Sonnenlicht in elektrischen Strom umwandelt – beeinflusst die Gesamtleistung des Moduls.
Compliance
Einhaltung von rechtlichen, ethischen und technischen Standards – wichtig für PV-Projekte im Unternehmensumfeld.
Cross-Selling
Strategie zur Angebotserweiterung: Z.B. Verkauf von Speichern, Wallboxen oder Energieberatungen zusätzlich zur PV-Anlage.
Component Monitoring
Detaillierte Überwachung einzelner Komponenten einer PV-Anlage (z.B. Module, Wechselrichter, Speicher) – dient der Fehleranalyse und Effizienzsteigerung.
Dachpacht
Ein Modell, bei dem der Betreiber einer PV-Anlage die Dachfläche eines Gebäudes mietet, um dort Solarstrom zu erzeugen. Der Gebäudeeigentümer erhält dafür eine Pachtzahlung. Haben Sie ein Dach zu verpachten? German Energies sieht sich Ihre Dachfläche (ab 500 m2) gerne genauer an https://germanenergies.com/photovoltaik-grossdachanlagen-pacht/
Direktverbrauch
Strom aus einer PV-Anlage, der direkt im Gebäude genutzt wird, ohne ins öffentliche Netz eingespeist zu werden – erhöht die Wirtschaftlichkeit deutlich.
Dachanlagen
PV-Anlagen, die auf Gebäudedächern installiert werden – im Gegensatz zu Freiflächenanlagen. Sie sind oft genehmigungsfrei und besonders platzsparend.
DC-Leitung
Gleichstromleitung zwischen Solarmodulen und Wechselrichter. Muss sorgfältig geplant und verlegt werden, da hohe Spannungen auftreten.
Degradation
Der natürliche Leistungsverlust von PV-Modulen im Laufe der Jahre – meist ca. 0,3 bis 0,5 % pro Jahr. Hochwertige Module haben niedrigere Degradationsraten.
Drosselung
Auch als Curtailment bekannt: Begrenzung der Einspeiseleistung einer PV-Anlage bei Netzengpässen oder zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
Dachneigung
Der Winkel des Daches beeinflusst den Ertrag der PV-Anlage. Optimal in Deutschland: ca. 30° bei Südausrichtung.
Dunkelstrom
Phantomverbrauch in Elektrogeräten, die im Standby-Modus weiter Strom ziehen. Relevant für die Eigenverbrauchsoptimierung.
Dioden (Bypass)
Schutzdioden in PV-Modulen, die verhindern, dass verschattete Zellen die Leistung der gesamten Modulreihe negativ beeinflussen.
Dachlastreserve
Der Teil der Dachstatik, der zusätzliche Lasten wie PV-Module tragen kann – muss vor der Installation geprüft werden.
Drittstromlieferung
Wenn der erzeugte Strom nicht nur vom Eigentümer, sondern auch an Dritte im Gebäude (z.B. Mieter) geliefert wird – rechtlich komplex.
Dynamische Einspeisung
Steuerbare Einspeisung von PV-Strom ins Netz – angepasst an Verbrauch oder Netzkapazität. Wichtig für Netzstabilität und Smart-Grid-Anwendungen.
Datenschnittstelle
Verbindet Wechselrichter, Speicher oder Smart Meter mit dem Monitoring-System – meist via RS485, Ethernet oder WLAN.
Dampfdruck
Relevanter physikalischer Parameter z.B. bei Wärmepumpen oder Solartrocknern. Beeinflusst Wirkungsgrad und Systemdesign.
Dämmwert
Gibt an, wie gut ein Material Wärme isoliert. Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch – vor allem bei Gebäudesanierungen.
Dezentrale Energieversorgung
Energieerzeugung direkt beim Verbraucher, z.B. durch PV-Anlagen auf dem eigenen Dach. Entlastet Netze und senkt Verluste.
Direktvermarktung
Verkauf von Strom aus PV-Anlagen an der Strombörse oder an Kunden – ohne feste Einspeisevergütung. Erfordert meist ein virtuelles Kraftwerk.
Durchleitungsentgelt
Gebühr für die Nutzung öffentlicher Stromnetze durch fremde Anbieter – z. B. bei Direktstromlieferung über mehrere Grundstücke.
Dämmmaterial
Materialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Schaumglas zur thermischen Isolierung von Gebäuden – reduziert Heiz- und Kühlenergiebedarf.
DC-Optimierer
Modulweise Leistungselektronik, die den Stromfluss einzelner Module optimiert – besonders bei Verschattung oder Modul-Mix hilfreich.
Einspeisevergütung
Eine gesetzlich geregelte Zahlung pro eingespeister Kilowattstunde Strom ins öffentliche Netz. Dient als Anreiz für Betreiber erneuerbarer Energieanlagen, insbesondere PV-Anlagen.
Eigenverbrauch
Anteil des erzeugten PV-Stroms, der direkt vor Ort verbraucht wird. Spart Stromkosten und erhöht die Rentabilität einer Solaranlage.
Erneuerbare Energien
Energiequellen, die sich natürlich regenerieren – z.B. Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie. Im Zentrum der Energiewende.
EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)
Gesetzliche Grundlage für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland. Regelt Vergütung, Netzanschluss und Fördermechanismen.
Energieeffizienz
Maß für den Energieverbrauch im Verhältnis zur Leistung. Ziel ist, mit möglichst wenig Energie möglichst viel Nutzen zu erzeugen.
Energieausweis
Dokument zur Bewertung des Energieverbrauchs eines Gebäudes – Pflicht bei Verkauf oder Vermietung. Bezieht sich auf Heiz- und Stromverbrauch.
E-Mobilität
Mobilitätskonzepte, die auf elektrisch betriebenen Fahrzeugen basieren – eng verknüpft mit der Nutzung erneuerbarer Energien.
Energiemanagement-System (EMS)
Software oder Hardwarelösung zur Überwachung und Steuerung des Energieflusses in Gebäuden oder Betrieben – für mehr Effizienz.
Energiespeicher
Systeme zur Zwischenspeicherung von Strom – z.B. Lithium-Ionen-Batterien – um Erzeugung und Verbrauch zeitlich zu entkoppeln.
Energieflussdiagramm
Visualisiert die Energieflüsse in einem Gebäude oder System – z.B. aus PV, Netzbezug, Speicher und Verbrauch.
Energieberater
Fachleute, die Gebäude energetisch analysieren, Maßnahmen zur Effizienzsteigerung empfehlen und bei Förderungen beraten.
Energiewende
Politischer und gesellschaftlicher Prozess zur Umstellung auf ein nachhaltiges Energiesystem – weg von fossilen, hin zu erneuerbaren Energien.
Erdwärme
Nutzung der im Erdinneren gespeicherten Wärmeenergie, etwa durch Wärmepumpen oder geothermische Kraftwerke.
Energiebedarfsausweis
Art des Energieausweises, der den theoretischen Energiebedarf eines Gebäudes auf Basis von Baujahr, Dämmung und Technik ermittelt.
Energieeinsparverordnung (EnEV)
Frühere Verordnung zur Regelung von energetischen Anforderungen an Gebäude in Deutschland. Inzwischen ersetzt durch das GEG.
Energiepreisbremsen
Staatliche Maßnahmen zur Deckelung von Strom-, Gas- oder Wärmepreisen, um Verbraucher vor starken Kostensteigerungen zu schützen.
Energieautarkie
Zustand, in dem ein Haushalt oder Betrieb seinen Energiebedarf vollständig selbst deckt – durch PV, Speicher und ggf. Wärmepumpe.
Erzeugungszähler
Gerät zur Messung der insgesamt erzeugten Strommenge einer PV-Anlage – wichtig für Abrechnungen und Monitoring.
Einspeisepunkt
Stelle im Stromnetz, an der der erzeugte Strom einer Anlage in das öffentliche Netz eingespeist wird – muss technisch abgestimmt sein.
Energiegenossenschaft
Zusammenschluss mehrerer Personen zur gemeinschaftlichen Umsetzung und Finanzierung von Energieprojekten, z.B. PV- oder Windparks.
Förderprogramm
Staatliche oder regionale finanzielle Unterstützung für Investitionen in erneuerbare Energien, Energieeffizienz oder Sanierungen.
Flachdach
Eine beliebte Dachform für PV-Anlagen – meist mit spezieller Unterkonstruktion zur optimalen Neigung und Ausrichtung der Module.
Fossile Energieträger
Nicht-erneuerbare Energiequellen wie Kohle, Erdöl und Erdgas. Verursachen CO₂-Emissionen und stehen im Zentrum der Energiewende-Debatte.
Finanzierungsmodell
Verschiedene Wege zur Realisierung von PV-Anlagen – z.B. Kauf, Pacht, Leasing oder Contracting. Einfluss auf Cashflow und Eigentum.
Fremdstrombezug
Strom, der nicht selbst erzeugt, sondern vom Energieversorger bezogen wird – meist teurer als Eigenstrom aus PV-Anlagen.
Freiflächenanlage
Eine PV-Anlage, die auf unbebauten Flächen errichtet wird – z.B. auf Ackerland oder ehemaligen Industriearealen.
Fördersätze
Die Höhe der staatlichen Unterstützung für Energieprojekte – z.B. pro Kilowattstunde Einspeisung oder pro Quadratmeter Sanierung.
Fehlanpassungsverlust
Leistungsverlust in einer PV-Anlage durch unterschiedliche Ausrichtung, Verschattung oder Alterung einzelner Module.
Frequenzregelung
Mechanismus zur Stabilisierung der Netzfrequenz im Stromnetz – entscheidend für Netzsicherheit und Blackout-Vermeidung.
Finetrading
Alternative Finanzierungsform: Ein externer Dienstleister bezahlt vorab Lieferanten und gewährt dem Auftraggeber verlängerte Zahlungsziele.
Feuerwehrschalter
Schalter zur Spannungsfreischaltung von PV-Leitungen im Brandfall – erhöht die Sicherheit für Einsatzkräfte.
Fernüberwachung
Digitale Kontrolle und Analyse von PV-Anlagen aus der Ferne – hilft bei Wartung, Fehleranalyse und Effizienzoptimierung.
Fördermittelberatung
Unterstützung bei der Auswahl und Beantragung geeigneter Förderprogramme für energieeffiziente Maßnahmen oder PV-Projekte.
Fachplaner
Spezialisten für die Planung technischer Anlagen wie Photovoltaik, Heizung, Lüftung – entscheidend für reibungslose Umsetzung.
Feinstaubbelastung
Luftverschmutzung durch kleinste Partikel – verringert sich durch Umstieg auf erneuerbare Energien und E-Mobilität.
Fahrplanmanagement
Planung der Einspeisemengen ins Stromnetz bei größeren PV- oder Windanlagen – wichtig für Netzbetreiber und Direktvermarkter.
Fachverband
Organisierte Interessenvertretung einer Branche, z.B. BSW-Solar für die Solarwirtschaft. Unterstützt politische und technische Themen.
Flankenschutz
Maßnahmen zur Absicherung eines Projekts – z.B. rechtlich, finanziell oder technisch – um Risiken zu minimieren.
Festpreisvertrag
Vertrag mit fixem Preis für PV-Anlagen oder Komponenten – sichert Planungssicherheit, kann aber Risiken bei Kostenanstieg beinhalten.
Grundlast
Die minimale Strommenge, die im Stromnetz dauerhaft benötigt wird – unabhängig von Tageszeit oder Wetter.
German Energies
Eines der führenden Photovoltaikunternehmen in Deutschland. Decken die gesamte Wertschöpfungskette einer Photovoltaik-Entstehung inhouse ab, sowohl im KAUF als auch im PACHT Modell..
Gleichstrom
Elektrischer Strom, der konstant in eine Richtung fließt – wird z.B. von Solarmodulen erzeugt und im Wechselrichter umgewandelt.
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Gesetzliche Grundlage für energetische Anforderungen an Gebäude – relevant für Dämmung, Heizung und Solaranlagen.
Genehmigungsverfahren
Verwaltungsprozess zur rechtlichen Prüfung und Freigabe eines Bau- oder Energieprojekts, z.B. bei großen PV-Freiflächenanlagen.
Gesamtnutzungsdauer
Zeitraum, über den eine PV-Anlage wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden kann – meist zwischen 25 und 30 Jahren.
Gebäudetechnik
Umfasst Heizung, Lüftung, Solar, Elektrotechnik – zentral für die Energieeffizienz moderner Immobilien.
Grid Parity
Der Punkt, an dem selbst erzeugter Solarstrom günstiger ist als Strom vom Netz – inzwischen in vielen Regionen erreicht.
Geothermie
Nutzung der Erdwärme zur Strom- und Wärmeerzeugung – eine konstante, grundlastfähige erneuerbare Energiequelle.
Gewerbesteuer
Steuer auf den Ertrag eines Unternehmens – relevant bei gewerblich genutzten PV-Anlagen und für Investorenmodelle.
Gutschriftmodell
Modell bei der Einspeisevergütung: Die Einspeisung wird dem Betreiber gutgeschrieben und mit dem Verbrauch verrechnet.
Grünstrom
Strom, der aus erneuerbaren Quellen stammt – z.B. Solar, Wind, Wasser, Biomasse. CO₂-frei und nachhaltig.
Gridfeed-In
Englischer Begriff für die Einspeisung von Strom aus dezentralen Quellen wie PV-Anlagen ins öffentliche Netz.
Glas-Glas-Modul
PV-Modul, bei dem die Solarzellen zwischen zwei Glasschichten liegen – erhöht Haltbarkeit und Ertrag.
Globalstrahlung
Die gesamte Sonneneinstrahlung auf eine definierte Fläche – Grundlage für die Planung von Solaranlagen.
Grundversorgung
Basistarif eines lokalen Energieversorgers – oft teuer, aber gesetzlich geregelt und jederzeit kündbar.
Gebäudeautomation
Digitale Steuerung von Licht, Heizung, Lüftung und PV – steigert Energieeffizienz und Komfort.
Gestehungskosten
Gesamtkosten, die bei der Erzeugung einer Kilowattstunde Strom entstehen – wichtig für Wirtschaftlichkeitsvergleiche.
Gegenstromprinzip
Verfahren zur Wärmerückgewinnung – z.B. in Wärmetauschern, bei denen warme und kalte Luftströme effizient Energie übertragen.
Garantieertrag
Vertraglich zugesicherter Mindestenergieertrag einer PV-Anlage – besonders für Investorenmodelle relevant.
Haushaltsstrom
Elektrische Energie, die für den alltäglichen Verbrauch in privaten Haushalten genutzt wird.
Heizlast
Die maximale Wärmemenge, die ein Gebäude benötigt, um auch an kalten Tagen eine gewünschte Innentemperatur zu halten.
Hybridanlage
Kombination verschiedener Energiequellen wie Solar, Wind und Biomasse in einem System.
Hochspannung
Spannungsbereich ab etwa 1.000 Volt, notwendig für den Ferntransport von elektrischer Energie.
Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Heizungsanlage zur gleichmäßigen Wärmeverteilung im Gebäude.
Holzpellets
Presslinge aus Holzabfällen, die als Brennstoff in Pelletheizungen dienen.
Heizwert
Energiemenge, die bei der Verbrennung eines Stoffes ohne Kondensation des Wasserdampfs freigesetzt wird.
Herkunftsnachweis
Zertifikat, das belegt, aus welcher Energiequelle eine Kilowattstunde Strom stammt.
Heizstab
Elektrisches Heizelement zur Wärmeerzeugung, häufig in Pufferspeichern eingesetzt.
Hauseinspeisung
Direkte Einspeisung von selbst erzeugtem Strom in das eigene Hausnetz.
Hocheffizienzpumpe
Moderne Umwälzpumpe mit besonders geringem Stromverbrauch.
Hybridheizung
System, das zwei oder mehr Heiztechnologien kombiniert (z. B. Gas + Solar).
Heizöl
Fossiler Brennstoff auf Erdölbasis, der in Ölheizungen eingesetzt wird.
Heizkostenverordnung
Rechtliche Grundlage für die Abrechnung von Heiz- und Warmwasserkosten in Mehrfamilienhäusern.
Heizleistung
Die von einem Heizgerät abgegebene Wärmemenge pro Zeiteinheit.
Hochtemperatur-Wärmepumpe
Wärmepumpe, die besonders hohe Vorlauftemperaturen erreichen kann.
Heizkurve
Stellt den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und Vorlauftemperatur der Heizung dar.
Hackschnitzel
Zerkleinertes Holz, das als Brennstoff für Biomasseheizungen dient.
Heizperiode
Zeitspanne innerhalb eines Jahres, in der Gebäude beheizt werden müssen.
Heizregister
Komponente zur Wärmeübertragung in Lüftungsanlagen oder Heizsystemen.
Inselanlage
Ein vom öffentlichen Stromnetz unabhängiges System zur Energieversorgung, meist mit PV und Speicher.
Intelligente Stromzähler
Digitale Zähler, die Stromverbrauch in Echtzeit erfassen und kommunizieren können.
Inverter
Wandelt Gleichstrom (z. B. aus PV-Anlagen) in Wechselstrom für das Stromnetz um.
Isolationswiderstand
Messgröße für die elektrische Sicherheit von Leitungen und Geräten.
Installationskosten
Gesamtkosten für die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme einer Anlage.
Investitionskosten
Einmalige Aufwendungen zur Anschaffung einer technischen Anlage.
Infrarotheizung
Heizung, die mittels Strahlungswärme Räume direkt erwärmt.
Indach-Montage
Photovoltaikanlage wird direkt in die Dachfläche integriert, ersetzt teilweise Dachmaterialien.
Intelligentes Stromnetz (Smart Grid)
Ein Stromnetz, das Energieflüsse digital überwacht und dynamisch steuert.
Isolierglas
Mehrfachverglasung mit verbessertem Wärmeschutz zur Reduktion von Heizenergieverlusten.
Innenwiderstand
Widerstand eines Energiespeichers gegen den Stromfluss, beeinflusst Lade- und Entladeleistung.
Installateurverzeichnis
Liste qualifizierter Fachbetriebe zur Anmeldung von PV- und Stromanlagen beim Netzbetreiber.
Inbetriebnahmeprotokoll
Dokumentation der erstmaligen Inbetriebnahme einer technischen Anlage.
Intensivverbraucher
Geräte oder Anlagen mit besonders hohem Strom- oder Wärmebedarf.
Ionenaustauscher
Technologie zur Wasserenthärtung, etwa in Heiz- und Kühlsystemen.
Insolationswert
Maß für die Sonneneinstrahlung an einem bestimmten Ort – wichtig für PV-Potenzial.
Innenraumklima
Zusammenspiel aus Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in geschlossenen Räumen.
Injektionsleistung
Leistung, die ein Erzeuger (z. B. PV) in ein Netz einspeisen darf.
Integraler Planungsansatz
Ganzheitliche Planung aller Gebäudesysteme mit Blick auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.
Installationsplan
Technische Zeichnung, die alle Komponenten und Leitungsverläufe einer Anlage darstellt.
Jahresarbeitszahl (JAZ)
Kennzahl zur Effizienz einer Wärmepumpe: Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetztem Strom über ein Jahr.
Joule
Maßeinheit für Energie; ein Joule ist die Energie, die benötigt wird, um einen Körper mit einem Newton über einen Meter zu bewegen.
Jahresnutzungsgrad
Verhältnis der genutzten zur zugeführten Energie über ein Jahr – wichtig bei Heizsystemen.
Jahresstromverbrauch
Gesamte Strommenge, die ein Haushalt oder ein Gerät pro Jahr verbraucht – gemessen in kWh.
Just-in-time-Erzeugung
Prinzip, bei dem Energie genau in dem Moment erzeugt wird, in dem sie benötigt wird – z. B. bei Gaskraftwerken oder PV.
Jahresganglinie
Darstellung des Energieverbrauchs oder -ertrags über ein Jahr, um saisonale Schwankungen sichtbar zu machen.
Jalousiesteuerung
Automatisiertes System zur Steuerung von Rollläden/Jalousien zur Optimierung von Licht und Wärmeeintrag.
Jahresenergiebedarf
Energiemenge, die ein Gebäude oder eine Anlage über ein Jahr benötigt, z. B. für Heizen, Warmwasser und Strom.
Jahresmitteltemperatur
Durchschnittliche Außentemperatur eines Standortes über ein Jahr – wichtig für Heizlastberechnungen.
Jahresheizgrenztemperatur
Außentemperatur, ab der eine Heizung aktiv wird – darunter beginnt der Heizbedarf.
Jahresertrag
Menge an Energie, die eine Anlage (z. B. PV-Anlage) innerhalb eines Jahres produziert.
Jalousieeffekt
Effekt der Verschattung durch verstellbare Lamellen, um Überhitzung und Blendung zu vermeiden.
Jahresnutzenergiebedarf
Die Energiemenge, die tatsächlich zur Deckung eines Bedarfs erforderlich ist – z. B. Raumwärme.
Joule-Effekt
Wärmeentwicklung bei Stromfluss durch einen Leiter – auch „Widerstandsheizung“ genannt.
Jahresverbrauchspreis
Gesamtkosten eines Stromtarifs für ein Jahr, bestehend aus Grundgebühr und Verbrauchspreis.
Jahresertragsprognose
Prognose der Stromproduktion einer Anlage für ein Jahr – wichtig für Wirtschaftlichkeitsrechnungen.
Jalousien mit PV
Jalousien mit integrierten Solarzellen – erzeugen Strom und bieten gleichzeitig Verschattung.
Just-in-time-Wartung
Wartungskonzept, bei dem technische Eingriffe erst bei tatsächlichem Bedarf erfolgen – effizient & kostensparend.
Jährlicher Wirkungsgrad
Kennzahl zur Beurteilung, wie viel eingesetzte Energie in einem Jahr effektiv genutzt wurde.
Jahresarbeitszeitmodell
Organisationsmodell, bei dem Mitarbeiter über das Jahr verteilt flexible Arbeitszeiten haben – in Energiebranche z. B. bei Projektarbeit.
Kilowatt (kW)
Eine Maßeinheit für Leistung, die angibt, wie viel Energie pro Sekunde umgesetzt wird. 1 kW = 1000 Watt.
Kilowattstunde (kWh)
Maßeinheit für Energie. Sie beschreibt, wie viel Energie verbraucht oder erzeugt wird, wenn 1 kW Leistung eine Stunde lang erbracht wird.
Klimaschutz
Alle Maßnahmen, die zur Reduktion des Ausstoßes von Treibhausgasen beitragen, um den Klimawandel zu verlangsamen.
Kollektor
Technisches Bauteil, das Sonnenenergie einfängt und in nutzbare Energieform (z. B. Wärme) umwandelt.
Kühlkette
System zur konstanten Temperierung sensibler Produkte – bei Stromausfall riskant, daher oft durch PV-Backup geschützt.
Konversionsfläche
Fläche, die vormals industriell oder militärisch genutzt wurde und für erneuerbare Energien umgewidmet wird.
Kohlenstoffdioxid (CO2)
Treibhausgas, das bei Verbrennungsprozessen entsteht und für den Klimawandel mitverantwortlich ist.
Kohleausstieg
Politisch und wirtschaftlich geplanter Rückzug aus der Kohleverstromung zugunsten klimafreundlicher Alternativen.
Kapazität
In der Energietechnik oft verwendet für die Energiemenge, die ein Speicher (z. B. Batterie) aufnehmen kann.
Kopplung der Sektoren
Die intelligente Verbindung von Strom, Wärme und Mobilität, um Synergieeffekte in der Energiewende zu erzielen.
Kilovoltampere (kVA)
Einheit der Scheinleistung in Wechselstromsystemen – wichtig für die Dimensionierung von Netzanschlüssen.
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
Technologie, bei der Strom und nutzbare Wärme gleichzeitig erzeugt werden – effizienter als getrennte Erzeugung.
Kleinanlage
Photovoltaikanlage mit geringer Leistung, meist für Privathaushalte. Oft mit vereinfachtem Netzanschluss möglich.
KfW-Förderung
Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau, unter anderem für energetische Sanierungen und PV-Anlagen.
Kilopreis
Begriff aus der Wirtschaftlichkeit: Preis pro installierter Kilowattstunde bei Speicher- oder PV-Anlagen.
Konverterstation
Technische Einrichtung zur Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom oder umgekehrt – wichtig für Stromnetze.
Kabelquerschnitt
Technisches Maß, das den Durchmesser eines Kabels beschreibt – entscheidend für die Verluste und Sicherheit.
Klimaabkommen
Internationale Verträge (z. B. Pariser Abkommen), die den globalen Temperaturanstieg begrenzen sollen.
Kaltreserve
Stromerzeugungsanlage, die nicht dauerhaft in Betrieb ist, aber bei Bedarf kurzfristig einspringen kann.
Kapazitätsmarkt
Marktmechanismus, bei dem Kraftwerke für die Bereitstellung von Leistung vergütet werden – unabhängig vom Stromverkauf.
Lastmanagement
Strategie zur gezielten Steuerung des Stromverbrauchs, um Lastspitzen zu vermeiden.
Leistung
Die Energiemenge, die pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Gemessen in Watt (W).
Leistungsoptimierer
Gerät, das den Energieertrag einzelner PV-Module maximiert, besonders bei Verschattung.
Leistungsregelung
Technologie zur Anpassung der Stromerzeugung, z. B. zur Netzintegration von Erneuerbaren.
Leistungselektronik
Teilgebiet der Elektrotechnik zur Steuerung elektrischer Energie mit elektronischen Schaltungen.
Ladeinfrastruktur
Gesamtheit aller Einrichtungen zum Laden von E-Fahrzeugen, inkl. Ladesäulen und Backend-Systemen.
Ladepunkt
Einzelner Anschluss an einer Ladesäule, an dem ein E-Fahrzeug geladen werden kann.
Leistungsgarantie
Herstellergarantie auf die langfristige Leistungsfähigkeit von Solarmodulen, meist über 25 Jahre.
Ladeleistung
Die Energiemenge pro Zeiteinheit, mit der ein E-Auto geladen wird. Angegeben in kW.
Leistungsspitze
Kurzfristiger Höchstwert beim Stromverbrauch oder der Erzeugung in einem bestimmten Zeitraum.
Leistungsbegrenzung
Vorgabe, die maximale Einspeiseleistung einer PV-Anlage zu begrenzen – z. B. auf 70 % der Modulleistung.
Leerrohr
Rohr ohne Leitungen, das für spätere Kabelverlegungen genutzt wird – wichtig für PV-Installationen.
Langfristiger Stromvertrag
Vertrag mit fixem Preis über mehrere Jahre, z. B. in PPA-Modellen (Power Purchase Agreement).
Leistungsdichte
Verhältnis von Leistung zur Fläche eines Solarmoduls – wichtig für Flächeneffizienz.
Leistungsfluss
Bewegung elektrischer Energie durch ein Stromnetz – entscheidend für Netzplanung.
Lichtbogen
Elektrischer Funke, der bei Unterbrechung von Stromkreisen entstehen kann – gefährlich bei PV.
Lumen
Maßeinheit für Lichtstrom – gibt an, wie viel Licht eine Lichtquelle pro Sekunde abgibt.
Leitungsverlust
Verlust von elektrischer Energie durch Erwärmung der Leitungen – je länger, desto größer.
Lastausgleich
Maßnahme zur Glättung von Verbrauchsspitzen – z. B. durch Zwischenspeicherung.
Leitungsquerschnitt
Durchmesser eines Kabels – wichtig für Stromtragfähigkeit und Sicherheit.
Modulwirkungsgrad
Der Modulwirkungsgrad beschreibt, wie effizient eine Photovoltaikzelle Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt. Er ist ein entscheidender Faktor für die Leistungsfähigkeit eines Solarmoduls.
Montagesystem
Ein Montagesystem dient zur Befestigung von PV-Modulen auf Dächern oder Freiflächen. Es muss sowohl statisch stabil als auch auf die jeweilige Dachart abgestimmt sein.
Mieterstrommodell
Ein Mieterstrommodell ermöglicht es, PV-Strom direkt an Mieter im gleichen Gebäude zu verkaufen, ohne das öffentliche Netz zu nutzen – oft günstiger und umweltfreundlicher.
Modulverschaltung
Die Modulverschaltung bezeichnet die elektrische Verbindung mehrerer PV-Module in Reihen- oder Parallelschaltung, um die gewünschte Spannung und Leistung zu erzielen.
Monitoring
Monitoring-Systeme überwachen die Leistung einer PV-Anlage in Echtzeit. Fehler oder Leistungsverluste können frühzeitig erkannt und behoben werden.
Messkonzept
Das Messkonzept legt fest, wie Energieflüsse in einer PV-Anlage erfasst und abgerechnet werden – z. B. beim Eigenverbrauch oder bei Einspeisung ins Netz.
Multikristallines Silizium
Ein häufig verwendetes Material für Solarzellen. Es ist kostengünstiger als monokristallines Silizium, aber etwas weniger effizient.
Messstellenbetreiber
Der Messstellenbetreiber ist für den Betrieb und die Wartung der Messeinrichtungen zuständig, oft ein Netzbetreiber oder ein unabhängiger Anbieter.
Marktprämie
Die Marktprämie ist ein staatlicher Zuschuss zur Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Quellen, als Ausgleich für schwankende Börsenpreise.
Moduleffizienz
Sie beschreibt das Verhältnis der abgegebenen Energie eines Solarmoduls zur eingestrahlten Sonnenenergie. Je höher, desto besser.
Mobilitätswende
Ziel der Mobilitätswende ist es, den Verkehr nachhaltiger zu gestalten – z. B. durch E-Mobilität, ÖPNV-Ausbau oder alternative Antriebskonzepte.
Midscale-PV
PV-Anlagen im Bereich von ca. 100 kWp bis 1 MWp, meist auf größeren Gewerbedächern oder Freiflächen, oft zur Eigenversorgung.
Megawatt
Ein Megawatt (MW) entspricht einer Leistung von 1.000.000 Watt und wird häufig für größere Solaranlagen oder Windparks verwendet.
Monokristallin
Monokristalline Solarmodule bestehen aus einer einzigen Siliziumstruktur und sind besonders effizient – allerdings auch teurer in der Herstellung.
Meteorologische Daten
Diese Daten sind essenziell für die Planung und Ertragsprognose von PV-Anlagen. Dazu gehören Sonneneinstrahlung, Temperatur, Wind etc.
Modulträger
Bauteil eines Montagesystems, der das PV-Modul physisch trägt und sicher am Untergrund befestigt ist.
Mindestabstand
Beim Bau von Freiflächenanlagen muss häufig ein Mindestabstand zu Siedlungen, Straßen oder anderen Anlagen eingehalten werden.
Mieterstromzuschlag
Zusätzliche Förderung für Betreiber von Mieterstrommodellen, um deren Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.
Moduleinspeisung
Bezeichnet die elektrische Energie, die direkt von einem Solarmodul ins Netz oder den Eigenverbrauch eingespeist wird.
Messkonzepte mit Speicher
Spezielle Messkonzepte berücksichtigen zusätzlich einen Stromspeicher in der Abrechnung, z. B. zur Eigenverbrauchsoptimierung.
Netzanschlusspunkt
Der Punkt, an dem eine Photovoltaikanlage mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden wird.
Nulleinspeisung
Eine Betriebsart, bei der kein Strom ins Netz eingespeist wird, sondern ausschließlich für den Eigenverbrauch produziert wird.
Niederspannungsnetz
Teil des Stromnetzes, das Haushalte und kleine Betriebe mit Strom versorgt (meist unter 1 kV).
Netzbetreiber
Unternehmen, das für Betrieb, Wartung und Ausbau des Stromnetzes in einem bestimmten Gebiet verantwortlich ist.
Netzparität
Erreicht, wenn Strom aus erneuerbaren Energien genauso viel kostet wie Strom aus dem Netz.
Nutzungsgrad
Verhältnis von nutzbarer Energie zur eingesetzten Energie in einem technischen System.
Nachtstrom
Vergünstigter Stromtarif in den Nachtstunden – ursprünglich zur besseren Netz-Auslastung gedacht.
Nennleistung
Maximale elektrische Leistung, die ein Solarmodul unter Standard-Testbedingungen liefert.
Netzrückspeisung
Überflüssiger Strom aus der PV-Anlage wird ins öffentliche Netz eingespeist.
Niederschlagsenergie
Energie, die durch fallenden Regen oder Schnee erzeugt bzw. beeinflusst wird – z. B. bei Wasserkraft.
Netzentgelte
Gebühren, die für die Nutzung des Stromnetzes anfallen und vom Endverbraucher mitgetragen werden.
Netzstabilität
Maß für die Zuverlässigkeit und Ausgeglichenheit eines Stromnetzes – entscheidend für die Versorgungssicherheit.
Nachhaltigkeit
Prinzip, Ressourcen so zu nutzen, dass sie zukünftigen Generationen erhalten bleiben.
Nachführung
Mechanismus zur automatischen Ausrichtung von Solarmodulen nach dem Sonnenstand zur Leistungssteigerung.
Nachtverbrauch
Stromverbrauch, der nachts anfällt – wichtig zur Berechnung von Speichergrößen und Autarkiegrad.
Netzfrequenz
Frequenz, mit der der Strom im Netz schwingt – in Europa beträgt sie 50 Hz.
Netzüberlastung
Zustand, bei dem das Stromnetz die aufgenommene Energie nicht mehr effizient verteilen kann.
Netzausbau
Erweiterung und Modernisierung des Stromnetzes, um z. B. erneuerbare Energien besser zu integrieren.
Netzagentur
Behörde, die u. a. den Strommarkt reguliert und für faire Rahmenbedingungen sorgt – in Deutschland: Bundesnetzagentur.
Netzanschlusskosten
Kosten, die für den Anschluss einer Anlage ans öffentliche Stromnetz entstehen.
Off-Grid-System
Ein Energiesystem, das unabhängig vom öffentlichen Stromnetz arbeitet – z. B. in entlegenen Gebieten.
Oberflächennahe Geothermie
Nutzung der Erdwärme in den obersten 400 Metern zur Wärmegewinnung für Gebäude.
Oszillierender Wassersäulen-Kraftwerk
Ein System zur Meeresenergiegewinnung, bei dem auf- und absteigende Wassersäulen Luft verdrängen und Turbinen antreiben.
Ökostrom
Elektrischer Strom, der aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wind, Wasser oder Biomasse stammt.
Oberleitungs-LKW
LKWs, die über Stromabnehmer während der Fahrt auf speziellen Straßenabschnitten geladen werden.
On-Grid-System
Ein Energiesystem, das mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist – oft bei Photovoltaikanlagen.
Ozon
Ein Gas, das in der Atmosphäre sowohl schädlich (Bodenniveau) als auch schützend (Stratosphäre) wirkt.
Oberflächenwasser
Flüsse, Seen und andere offene Gewässer – wichtig für Wasserkraft und Kühlprozesse in der Energieerzeugung.
Organisches Photovoltaikmodul
Solarzellen aus organischen Materialien – leicht, flexibel und potenziell kostengünstig.
Offshore-Windpark
Windkraftanlagen auf dem Meer, wo stärkere und konstantere Winde herrschen.
Öl-Ersatzquote
Kennzahl, wie viel eines Landes Energieverbrauchs durch alternative Quellen statt Öl gedeckt wird.
Oberwellen
Störungen im Stromnetz durch nicht-lineare Verbraucher – relevant bei der Einspeisung aus PV-Anlagen.
Oberleitung
Drahtsystem zur Energieversorgung von E-Fahrzeugen oder Zügen.
Off-Peak-Strom
Strom, der außerhalb der Spitzenlastzeiten günstiger angeboten wird.
Optimierer (PV)
Gerät, das einzelne PV-Module optimiert, um Schatten oder Ausfälle anderer Module auszugleichen.
Oszillierende Wellenkraft
Meereskraftwerke, die sich mit der Wellenbewegung synchronisieren und so Energie gewinnen.
Ölbindemittel
Substanzen, die Ölunfälle in der Industrie oder Umwelt entschärfen – wichtig bei Notfällen.
Oberflächenabkühlung
Effekt bei Solarmodulen, der durch gezielte Kühlung deren Effizienz verbessern kann.
Oberleitungsbus
Ein Bus, der elektrische Energie über Oberleitungen bezieht – emissionsfrei im Stadtverkehr.
Ökologischer Fußabdruck
Messgröße für den Ressourcenverbrauch eines Menschen, Unternehmens oder Landes.
Photovoltaik
Technologie zur Umwandlung von Sonnenlicht in elektrische Energie mithilfe von Solarzellen.
Peak Load
Höchstlast im Stromnetz, die meist zu bestimmten Tageszeiten auftritt und Netzkapazitäten beansprucht.
Pufferspeicher
Speicherbehälter zur Zwischenspeicherung von Wärme, z. B. bei Solarthermie- oder Pelletanlagen.
Primärenergie
Energieform, wie sie in der Natur vorkommt, bevor sie umgewandelt wird – z. B. Erdöl, Sonne, Wind.
Photovoltaikanlage
Ein System aus PV-Modulen, Wechselrichter, Verkabelung und ggf. Stromspeicher zur Stromerzeugung.
Power-to-Gas
Verfahren zur Umwandlung von überschüssigem Ökostrom in speicherbares Gas, z. B. Wasserstoff.
Power Purchase Agreement (PPA)
Langfristiger Stromliefervertrag zwischen Stromerzeuger und -abnehmer – oft bei Großprojekten genutzt.
PV-Überschussladung
Das Laden eines Batteriespeichers oder E-Autos mit dem überschüssigen Strom aus der PV-Anlage.
Photovoltaik-Optimierer
Gerät zur Leistungsmaximierung einzelner Module bei Verschattung oder Ausfall.
Passivhaus
Gebäudestandard mit extrem niedrigem Energiebedarf durch sehr gute Dämmung und Technik.
Perowskit-Solarzelle
Neue Generation von Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad und günstigem Materialeinsatz.
Photothermische Anlage
System, das Sonnenstrahlung in Wärme umwandelt – z. B. bei Solarkollektoren.
PV-Ertrag
Die Strommenge, die eine Photovoltaikanlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums produziert.
Pumpenspeicherkraftwerk
Stromspeicher, bei dem Wasser in höher gelegene Becken gepumpt und bei Bedarf abgelassen wird.
PV-Wechselrichter
Wandelt den Gleichstrom der PV-Module in haushaltsüblichen Wechselstrom um.
Photovoltaikförderung
Staatliche oder regionale Zuschüsse oder Einspeisevergütungen für PV-Anlagen.
PV-Modul
Baustein einer PV-Anlage, bestehend aus mehreren Solarzellen.
Primärenergiefaktor
Kennzahl, die angibt, wie viel Primärenergie für eine Kilowattstunde Endenergie nötig ist.
Photovoltaikleistung
Gibt die maximale elektrische Leistung einer PV-Anlage an – meist in Kilowattpeak (kWp).
Photovoltaikversicherung
Versicherungsschutz für Schäden an PV-Anlagen durch Wetter, Diebstahl oder Ausfall.
Querschnitt (Leiter)
Der elektrische Leitungsquerschnitt beeinflusst Strombelastbarkeit und Spannungsabfall. Ein zu geringer Querschnitt kann zu Überhitzung führen.
Qualitätsmanagement
Systematische Prozesse zur Sicherstellung gleichbleibend hoher Qualität bei Planung, Bau und Wartung von Energieanlagen.
Quotenmodell
Ein politisches Steuerungsinstrument, das Mindestanteile erneuerbarer Energien im Energiemix gesetzlich vorschreibt.
Quadratmeterleistung
Die Energieerzeugung pro Quadratmeter Modulfläche – eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Flächeneffizienz.
Repowering
Austausch alter PV-Anlagenkomponenten gegen neue, leistungsfähigere Technik zur Effizienzsteigerung.
Regelenergie
Reserveleistung, die Netzbetreiber zur Stabilisierung der Netzfrequenz einsetzen.
Rentabilität
Wirtschaftlichkeit eines Projekts – Ertrag im Verhältnis zu Investition und laufenden Kosten.
Rekuperation
Rückgewinnung von Energie, z. B. beim Bremsen eines E-Autos.
Recycling von PV-Modulen
Verfahren zur Rückgewinnung wertvoller Materialien aus ausgedienten Photovoltaik-Modulen.
Rendite
Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital – z. B. bei PV-Investitionen.
Rückspeisung
Einspeisung überschüssiger Energie aus PV-Anlagen ins öffentliche Stromnetz.
Rahmenvertrag
Vertragliche Vereinbarung mit standardisierten Bedingungen für mehrere Projekte oder Lieferungen.
Relevanzdach
Dachfläche mit hoher Eignung für wirtschaftliche PV-Nutzung (z. B. Ausrichtung, Größe, Statik).
Reaktionszeit
Zeit, die Systeme benötigen, um auf Laständerungen oder Netzschwankungen zu reagieren.
Rohrleitungssystem
Wichtig bei thermischen Solaranlagen, um Wärme effizient zu transportieren.
Regelzonen
Geografisch aufgeteilte Bereiche im Stromnetz, in denen Regelenergie verwaltet wird.
Rückvergütung
Gutschrift vom Netzbetreiber für eingespeisten Solarstrom.
Redox-Flow-Batterie
Speichertechnologie mit flüssigen Elektrolyten – skalierbar und langlebig, aber teuer.
Rechenzentrum
Ort mit hohem Energiebedarf – ideal für Direktlieferverträge mit PV-Großanlagen (z. B. über PPAs).
Rückbaupflicht
Gesetzliche Pflicht, PV-Anlagen nach Ende der Nutzung zurückzubauen und zu entsorgen.
Risikobewertung
Analyse möglicher finanzieller, technischer oder rechtlicher Risiken bei einem Projekt.
Regenerative Energie
Energie aus nachhaltigen Quellen wie Sonne, Wind, Wasser, Biomasse oder Geothermie.
Reststrombezug
Strom, der zusätzlich zur eigenen PV-Produktion aus dem Netz bezogen werden muss.
Relevanzanalyse
Bewertung der Bedeutung eines Projekts oder Themas für Strategie, Umsatz oder Nachhaltigkeit.
Solaranlage
System zur Umwandlung von Sonnenenergie in Strom oder Wärme – z. B. Photovoltaik oder Solarthermie.
Stromspeicher
Batteriesysteme, die erzeugten Strom zwischenspeichern und bei Bedarf abgeben – wichtig für Autarkie.
Solarzelle
Kleinstes funktionales Element einer PV-Anlage – wandelt Sonnenlicht direkt in Gleichstrom um.
Sonnenstunden
Anzahl der Stunden pro Jahr, in denen die Sonne ausreichend intensiv scheint – wichtig für Ertragsberechnung.
Solarmodul
Mehrere Solarzellen in einem Rahmen zusammengefasst – wird auf Dächern oder Flächen installiert.
Solarterrasse
Terrassenüberdachung mit integrierten PV-Modulen – ästhetisch und funktional zugleich.
Solarthermie
Technologie zur Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
Selbstverbrauchsquote
Anteil des selbst erzeugten Stroms, der im Gebäude direkt genutzt wird – je höher, desto wirtschaftlicher.
Süd-Ausrichtung
Optimale Dachausrichtung für maximale PV-Erträge auf der Nordhalbkugel – Süden ist meist ideal.
Solarkataster
Online-Tool vieler Städte zur Bewertung der Eignung von Dachflächen für Photovoltaik.
Schrägdach
Typisches Hausdach mit Neigung – meist sehr gut geeignet für PV-Anlagen.
Schattenwurf
Verschattung durch Bäume, Nachbargebäude oder Schornsteine kann die PV-Leistung erheblich reduzieren.
Sektorkopplung
Verknüpfung von Strom, Wärme und Mobilität – z. B. PV-Strom für Wärmepumpen oder E-Autos.
Smart Meter
Intelligenter Stromzähler zur präzisen Erfassung von Verbrauchs- und Einspeisedaten.
Solarpark
Großflächige PV-Anlage auf Freiflächen zur Stromproduktion in größerem Maßstab.
Solarfassade
Gebäudefassade mit integrierten PV-Modulen – kombiniert Stromproduktion mit architektonischer Gestaltung.
Speicherkapazität
Maximale Energiemenge, die ein Stromspeicher aufnehmen kann – gemessen in kWh.
Solarkampagne
Öffentliche Initiative oder Marketingaktion zur Förderung von PV-Ausbau in Regionen oder Unternehmen.
Subventionen
Finanzielle Unterstützung von staatlicher oder regionaler Seite für Investitionen in Photovoltaik und Speicher.
THG-Quote
Treibhausgasminderungs-Quote: Instrument zur Förderung emissionsfreier Technologien wie E-Mobilität.
Thermografie
Bildgebendes Verfahren zur Darstellung von Wärmeverlusten an Gebäuden – nützlich zur Effizienzsteigerung.
Transformator
Gerät zur Spannungsanpassung in Stromnetzen – spielt zentrale Rolle bei der Einspeisung aus PV-Anlagen.
Treibhausgas
Gase wie CO2 oder Methan, die zur Erderwärmung beitragen – deren Reduktion ist zentrales Ziel erneuerbarer Energien.
Tag-Nacht-Ausgleich
Maßnahme zur Energiespeicherung und -nutzung, um PV-Strom auch nachts verfügbar zu machen.
Tiefbau
Bautechnische Arbeiten unter der Erdoberfläche – etwa für Erdkabel oder Fundamentarbeiten bei PV-Projekten.
Tracking-System
Nachführsysteme, die PV-Module der Sonne nachdrehen – steigern die Effizienz auf Freiflächenanlagen.
Temperaturkoeffizient
Kennzahl, die angibt, wie stark die Leistung eines PV-Moduls bei steigender Temperatur abnimmt.
Tagesertrag
Gesamterzeugung einer PV-Anlage an einem einzelnen Tag – abhängig von Wetter, Ausrichtung und Technik.
Tiefenbohrung
Verfahren zur Nutzung von Erdwärme aus tieferen Bodenschichten – typisches Element bei Geothermieanlagen.
Technischer Netzanschluss
Formaler und technischer Prozess zur Anbindung einer Anlage an das öffentliche Stromnetz.
Thermische Solaranlage
Anlage zur Umwandlung von Sonnenlicht in Wärme – meist für Warmwasser oder Heizung genutzt.
Tonziegeldach
Häufig verwendete Dachart – PV-Montage erfordert spezielle Haken oder Befestigungssysteme.
Transformationsstrategie
Plan zur Umstellung auf nachhaltige Energieversorgung in Unternehmen oder Kommunen.
Trennrelais
Sicherheitskomponente, die bei Netzstörungen eine Anlage automatisch vom Netz trennt.
Tarifmodell
Strompreisstruktur eines Energieversorgers – beeinflusst Wirtschaftlichkeit von Eigenverbrauch.
Thermischer Speicher
Speichert Wärmeenergie – meist in Form von Wasser – zur späteren Nutzung, etwa in Solarthermieanlagen.
Transportverluste
Energieverluste beim Stromtransport über lange Distanzen – durch dezentrale PV-Systeme vermeidbar.
Totalenergieeffizienz
Gesamtwirkungsgrad eines Systems – berücksichtigt Stromerzeugung, Wärme und Verluste.
Ultrakondensator
Speicherelement mit hoher Leistungsdichte, ideal für kurzfristige Energieabgaben, z. B. in Schnellladeanwendungen.
Umrichter
Wandelt den von PV-Anlagen erzeugten Gleichstrom in netzkompatiblen Wechselstrom um.
Umwelteinflüsse
Wetter, Staub, Schnee und Verschattung beeinflussen die Effizienz und Lebensdauer von PV-Anlagen erheblich.
Umweltbilanz
Bewertung aller Umwelteinflüsse, die ein Produkt während seines gesamten Lebenszyklus verursacht.
Umweltbonus
Finanzielle Förderung für klimafreundliche Technologien, z. B. E-Autos oder PV-Anlagen.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
System zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung bei Netzstörungen – wichtig für sicherheitskritische Bereiche.
Unabhängigkeit vom Stromnetz
Ziel vieler PV-Betreiber: Eigenverbrauch maximieren und sich gegen steigende Strompreise absichern.
Unterspannungsschutz
Schutzmechanismus, der Geräte bei zu niedriger Spannung vom Netz trennt, um Schäden zu vermeiden.
Umsatzrendite
Wirtschaftliche Kennzahl, die angibt, wie profitabel ein Unternehmen oder ein PV-Projekt wirtschaftet.
Umweltschutz
Ziel aller erneuerbarer Energien – die Reduktion von CO₂, Abfällen und Eingriffen in die Natur.
Unterdachmontage
Montageform, bei der PV-Module in die Dachfläche integriert werden – optisch ansprechend, aber aufwändiger.
Ultraschallprüfung
Messmethode zur Prüfung von Schweißnähten und Materialien bei technischen PV-Komponenten.
Überwachungssystem
Monitoring-Systeme erfassen Leistung, Fehler und Betriebsdaten einer PV-Anlage in Echtzeit.
Umlaufverluste
Verluste durch kontinuierliches Zirkulieren von Fluiden, z. B. in thermischen Speichersystemen.
Umwandlungseffizienz
Prozentsatz der Sonnenenergie, die ein PV-Modul tatsächlich in nutzbaren Strom umwandelt.
Urbane Energiekonzepte
Strategien zur Integration von erneuerbaren Energien und Energiespeichern in städtische Infrastrukturen.
Umspannwerk
Anlage zur Transformation von Hoch- auf Mittelspannung – wichtig für die Netzanbindung großer PV-Anlagen.
Überdimensionierung
Bewusste Übergröße von PV-Anlagen zur besseren Deckung des Eigenverbrauchs oder zur besseren Ausnutzung von Wechselrichtern.
Unterzähler
Misst den Stromverbrauch einzelner Anlagenteile oder Nutzer – hilfreich bei der Abrechnung oder Lastanalyse.
Umlagen
Abgaben auf den Strompreis, z. B. zur Förderung erneuerbarer Energien – können durch Eigenverbrauch reduziert werden.
Verbrauchszähler
Gerät zur Erfassung des Stromverbrauchs – entscheidend für Abrechnung und Optimierung.
Verfügbarkeitsgarantie
Vertragliche Zusicherung, dass eine PV-Anlage oder Komponente eine bestimmte Zeit störungsfrei arbeitet.
Versorgungssicherheit
Zuverlässige und stabile Stromversorgung – ein wichtiges Ziel in der Energiewende.
Volt
Maßeinheit der elektrischen Spannung – gibt an, wie stark der Strom „gedrückt“ wird.
Verbrauchsoptimierung
Anpassung des Stromverbrauchs an die Verfügbarkeit von Solarstrom zur Maximierung des Eigenverbrauchs.
Verkabelung
Die Leitungsführung in PV-Anlagen – entscheidend für Effizienz, Sicherheit und Wartung.
Verlustleistung
Energie, die durch Wärme oder Widerstand in Leitungen und Geräten verloren geht.
Verschattung
Einfluss von Schatten auf PV-Module – kann Ertrag stark verringern und muss sorgfältig geplant werden.
Verschaltung
Die Verbindung mehrerer Solarmodule zu Strängen (Strings) – beeinflusst Ertrag und Verhalten bei Störungen.
Verstärker
Elektronisches Bauteil zur Signalverstärkung, z. B. in Überwachungssystemen von PV-Anlagen.
Verfügbarkeit erneuerbarer Energien
Hängt von Wetter, Tageszeit und Jahreszeit ab – beeinflusst Planung und Speicherbedarf.
Verrechnungspreis
Preis, zu dem eingespeister Strom vergütet oder innerhalb von Gemeinschaftsanlagen verrechnet wird.
Verteilnetz
Der Teil des Stromnetzes, der Strom zu Haushalten und Betrieben leitet – meist Mittel- oder Niederspannung.
Verteilnetzbetreiber (VNB)
Unternehmen, das das regionale Stromnetz betreibt und für Netzanfragen zuständig ist.
VDE-Norm
Technische Normen für elektrische Sicherheit und Netzverträglichkeit, z. B. bei PV-Anlagen.
Vergütungssätze
Beträge, die Betreiber für eingespeisten Strom erhalten – variieren je nach Fördermodell.
Versicherungen für PV-Anlagen
Sichern gegen Ertragsausfall, Diebstahl oder Schäden durch Unwetter und Technikversagen ab.
Verpackungsgesetz
Regelt Rücknahme und Recycling von Verpackungen – auch bei Solartechnik relevant.
Verbrauchsanalyse
Detaillierte Auswertung des Stromverbrauchs zur Optimierung von Speicher- und PV-Größen.
Vermarktung (Direktvermarktung)
PV-Betreiber können Strom direkt an der Börse oder an Stromhändler verkaufen – statt Einspeisevergütung.
Wärmepumpe
Ein Gerät, das Umgebungswärme aus Luft, Wasser oder Erde entzieht und zur Heizung oder Warmwasserbereitung nutzt – besonders effizient in Kombination mit PV.
Wirkungsgrad
Maß dafür, wie viel der aufgenommenen Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird – entscheidend für die Effizienz.
Wechselrichter
Gerät, das den von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in netzfähigen Wechselstrom umwandelt.
Watt
Einheit für Leistung – z. B. ein PV-Modul mit 400 W liefert unter optimalen Bedingungen 400 Watt Leistung.
Windkraft
Nutzung von Wind zur Stromerzeugung – eine der zentralen Säulen der erneuerbaren Energien.
Wartung
Regelmäßige Kontrolle und Instandhaltung einer PV-Anlage zur Sicherstellung der Leistung und Lebensdauer.
Wärmeverlust
Ungewollte Abgabe von Wärme – verringert die Energieeffizienz, besonders bei ungedämmten Gebäuden.
Wärmespeicher
System zur Speicherung überschüssiger Wärmeenergie, z. B. aus Solarthermie oder Wärmepumpen.
Wirtschaftlichkeit
Verhältnis von Kosten zu Nutzen einer PV-Anlage – beeinflusst durch Förderungen, Strompreise und Eigenverbrauch.
Wirkenergie
Die tatsächlich genutzte Energie – anders als Blindenergie, die nur für das Stromnetz notwendig ist.
Wattstunde (Wh)
Einheit für elektrische Arbeit – zeigt an, wie viel Strom in einer Stunde verbraucht oder produziert wurde.
Wärmebrücke
Bereich eines Gebäudes, in dem Wärme schneller nach außen gelangt – energetisch problematisch.
Weltenergierat
Internationale Organisation zur Förderung eines nachhaltigen Energiesystems weltweit.
Wechselstrom
Stromart, bei der die Richtung regelmäßig wechselt – typisch für das öffentliche Stromnetz.
Wirkleistung
Teil der elektrischen Leistung, der in einem Gerät tatsächlich in Arbeit oder Wärme umgesetzt wird.
Wellenkraft
Erneuerbare Energie aus der Bewegung von Meereswellen – noch wenig verbreitet, aber vielversprechend.
Wasserstoff
Speicherbare und vielseitig einsetzbare Energieform – erzeugt durch Elektrolyse mit grünem Strom.
Wasserstoffstrategie
Politische und wirtschaftliche Maßnahmen zur Förderung von grünem Wasserstoff als Energieträger.
Wandlungsverluste
Verluste, die beim Umwandeln von Energieformen entstehen – z. B. von Solarstrom in Batteriespeicherstrom.
Wärmepumpentarif
Sonderstromtarif für Wärmepumpen – oft günstiger als normale Haushaltsstromtarife.
Xenon
Ein seltenes Edelgas, das in der Energietechnik u. a. für spezielle Hochdrucklampen und ionenbasierte Antriebssysteme verwendet wird.
XPS-Dämmung
Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, eine Dämmplatte mit hoher Druckfestigkeit – eingesetzt zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
X-fache Isolierung
Begriff aus der Gebäudetechnik – beschreibt Mehrfachverglasung oder mehrfachen Schichtenaufbau zur Reduktion von Wärmeverlusten.
Xerothermie
Klimazustand mit heißem, trockenem Wetter – wirkt sich auf die Effizienz von Solarmodulen und Kühlbedarf von Gebäuden aus.
X-Faktor (Energiebilanz)
Inoffizieller Begriff für Einflussfaktoren in komplexen Energiebilanzen – z. B. Nutzerverhalten, unvorhersehbare Energieflüsse oder Netzverluste.
Yield (Stromertrag)
Bezeichnet den Stromertrag einer PV-Anlage, meist in kWh pro installiertem kWp – wichtig zur Bewertung der Effizienz.
Y-Achse (PV-Nachführung)
In der zweiachsigen Solarnachführung steht die Y-Achse für die horizontale Drehung der Solarmodule – verbessert die Energieausbeute.
Yttrium
Ein seltenes Metall, das in Hochtemperatur-Supraleitern und zur Verbesserung der Festigkeit von Materialien in Energietechnik eingesetzt wird.
Ytong
Markenname für Porenbeton, ein beliebter Baustoff mit guten Dämmwerten – relevant für energieeffizientes Bauen.
Y-Verkabelung (PV)
Eine Art der Verkabelung bei Solaranlagen, bei der zwei Strings zu einem zusammengeführt werden – spart Platz, birgt aber Verlustrisiken.
Zähler (Stromzähler)
Gerät zur Messung des Stromverbrauchs oder -ertrags – bei PV-Anlagen oft als Zwei- oder Vier-Richtungszähler ausgeführt.
Zellwirkungsgrad
Kennzahl, die angibt, wie effizient eine Solarzelle Sonnenlicht in elektrische Energie umwandelt – entscheidend für die Leistung.
Zyklische Lebensdauer
Anzahl der Lade- und Entladezyklen, die ein Energiespeicher übersteht, bevor seine Kapazität deutlich abnimmt.
Zentralwechselrichter
Ein großer Wechselrichter, der den Strom mehrerer Strings bündelt – typisch bei Freiflächenanlagen oder großen Dachanlagen.
ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch)
Modell, bei dem mehrere Nutzer gemeinsam eine PV-Anlage betreiben und den Strom gemeinschaftlich verbrauchen – v. a. in der Schweiz verbreitet.
Zonale Strahlung
Ein Maß für die auf eine bestimmte Zone bezogene Sonnenstrahlung – wichtig bei der Planung von Solaranlagen.
Zelltemperatur
Die Temperatur der Solarzelle – hat direkten Einfluss auf deren Wirkungsgrad. Höhere Temperaturen verringern meist die Leistung.
Zuschaltbare Last
Ein Gerät oder System, das bei überschüssiger Energie automatisch aktiviert wird – z. B. Wärmepumpen oder Speicher.
Zweirichtungszähler
Ein Stromzähler, der sowohl den bezogenen als auch den eingespeisten Strom erfasst – Standard bei PV-Anlagen mit Einspeisung.
Zertifizierung (PV-Komponenten)
Nachweis, dass Komponenten wie Wechselrichter oder Module bestimmte Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllen – wichtig für Förderungen.
